To be honest, wir verwenden immer mehr englische Wörter im Deutschen. Ich bin da wahrlich keine Ausnahme. Und überhaupt steckt unsere Sprache voller Anglizismen. Manche sind obvious, andere nicht. Sind englische Ausdrücke in deutschen Texten nun okay oder nicht? So gehe ich bei der Arbeit damit um.
Anglizismen, Denglisch, Scheinanglizismen
Erst mal möchte ich hier zwischen Anglizismen und Denglisch unterscheiden. Erstere sind laut Duden die „Übertragung einer für [das britische] Englisch charakteristischen sprachlichen Erscheinung auf eine nicht englische Sprache„.
Heißt also, dass Ausdrücke aus dem Englischen übernommen (cool, liken oder Work-Life-Balance) oder 1:1 übersetzt werden (Sinn machen von to make sense), wobei die Übergänge zum stilistisch unschönen Denglisch fließend sind. Wenn ich etwa in einem Text „einen Punkt haben“ (von to make a point) lese, der nicht von Satzzeichen oder dergleichen handelt, rollen sich mir regelmäßig alle neuneinhalb Fußnägel, brrr.
Denglisch ist auch, wenn übermäßig viele englische Ausdrücke oder Anglizismen in Kontexten verwendet werden, wo es eigentlich unangebracht ist, weil es dafür passende deutsche Begriffe gibt. Gerade im Businesskontext sehr beliebt:
Mein Zug wurde gecancelt, dadurch konnte ich dir Deadline für das Meeting nicht emailen, obwohl ich nine to five im Office war.
Ach, und dann sind da noch die Scheinanglizismen, englisch erscheinende Wörter, die wir auf Deutsch benutzen, die jedoch eine Person mit Englisch als Erstsprache sicher weird finden würde, weil sie dort was ganz anderes bedeuten. Zum Beispiel Oldtimer (old timer = ältere Person) oder checken (im Deutschen = verstehen, eigentlich to check = prüfen).
Ohne Englisch geht es nicht
Fakt ist: Englisch ist eine Lingua franca, die Menschen mit unterschiedlichen Erstsprachen nutzen, um sich miteinander verständigen zu können. Bestes Beispiel ist (neben meiner Ehe) die Wissenschaft: Dank Englisch als gemeinsamer Sprache können Forschende auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Ohne Englisch wäre beispielsweise die schnelle Entwicklung von Coronatests und -impfungen nicht möglich gewesen (tragt Masken, die Pandemie ist nicht vorbei!).
Logischerweise ist in vielen Fachgebieten und gerade in der Naturwissenschaft die Fachliteratur auf Englisch und sind englische Fachbegriffe zu finden, für die es beispielsweise auf Deutsch kein angemessenes Gegenstück gibt. Das betrifft insbesondere die Bezeichnungen von Methoden, etwa CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), das als Eigenname natürlich nicht übersetzt wird. Wie auch?
So gehe ich mit englischen Wörtern in deutschen Texten um
Mein Job als Lektor*in ist es, abzuwägen, ob die verwendeten Wörter zum Text passen, und gegebenenfalls Alternativen vorzuschlagen. Das schließt Anglizismen ein, die sind nämlich nicht automatisch falsch.
Beim Schreiben einer Bachelor- oder Masterarbeit und allen anderen wissenschaftlichen Texten ist es von wesentlicher Bedeutung, dass du die Fachsprache deines Forschungsbereichs verwendest. Darum kommst du um englische Wörter in deiner Abschlussarbeit nicht herum.
Englische Fachbegriffe, Eigennamen und so weiter lasse ich aus diesem Grund auf jeden Fall stehen. Oft gibt es eh keine treffende deutsche Entsprechung dafür. Oder wie würdest du Gain-of-function-Mutation übersetzen?
Wichtig ist, dass du in deiner Arbeit passend zur Zielgruppe solche Begriffe erklärst. In einer Dissertation können mehr Fachbegriffe bei den Lesenden als bekannt vorausgesetzt werden als in einem populärwissenschaftlichen Artikel.
Wie immer: Es hängt vom Text ab
Aber: Zu viel ist nicht gut. Da, wo es sich vermeiden lässt, wo englische Begriffe falsch verwendet wurden, überhand nehmen (siehe obiger Beispielsatz) oder umgangssprachlich oder cringy übersetzt sind (looking at you, Scheinanglizismen), werde ich sie beim Wissenschaftslektorat direkt ersetzen oder dir passende deutsche Formulierungen vorschlagen.
Allerdings sind viele Anglizismen so fest in unseren täglichen Sprachgebrauch verwoben, dass lockere Texte wie dieser Blogeintrag komisch klingen würden, wenn ich plötzlich „knorke“ statt „cool“ schreiben würde. Es sei denn, ich würde das bewusst als Stilmittel einsetzen (was ich tatsächlich gerne mal mache, heute aber nicht). Das heißt, in Belletristik, in Blogs, in Newslettern und so weiter dürfen sie unter Umständen stehen bleiben.
Und my lovely Mr. Singing Club kann es lustig sein, deutsche Redensarten ins Englische zu übersetzen. Ich wette, du grinst jetzt wie ein honey cake horse.
Mein Umgang mit englischen Wörtern in deutschen Texten richtet sich also danach, was für einen Text ich vor mir habe. Je lockerer er geschrieben ist, je weniger förmlich der Kontext, in dem er erscheint, desto umgangssprachlicher darf er sein, und da gehören Anglizismen einfach dazu. In wissenschaftlichen Texten ist es dagegen die Fachsprache, die stark vom Englischen geprägt ist, in denen aber andere Anglizismen eher nicht so gern gesehen sind.
Auf welche englischen Wörter kannst du im Alltag nicht mehr verzichten? Erzähl’s mir in den Kommentaren!


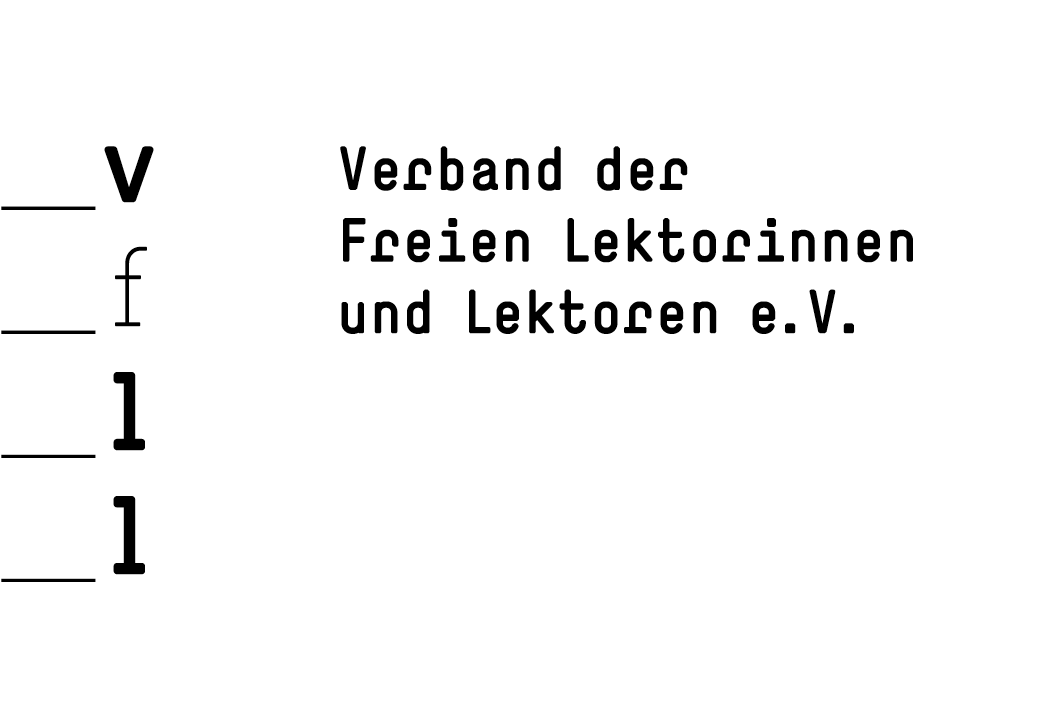
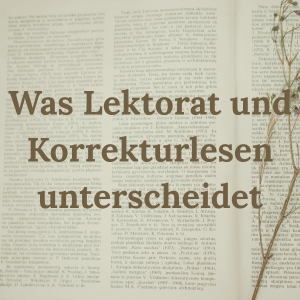
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!